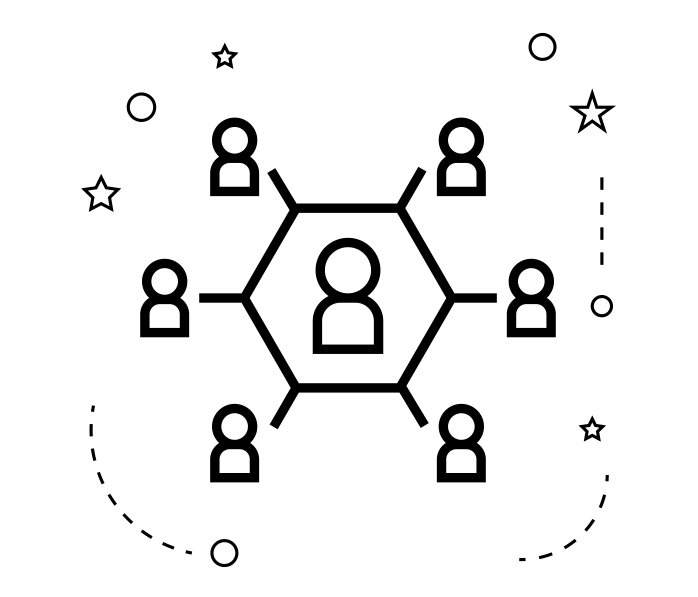Die nationalrätliche Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen hat beschlossen, dass weitere Abklärungen bezüglich der Förderung von Online-Medien nötig seien. Der Verband Medien mit Zukunft befürchtet dadurch eine Verzögerung beim dringend benötigten Medienförderungs-Paket.
Der Verband Medien mit Zukunft spricht sich seit Jahren für eine Print- als auch Onlinemedien-Förderung aus. Fördert der Bund wie bis anhin nur die traditionellen Medien, führt dies zu einer weiteren Abnahme der Medienvielfalt. Um den rasanten Strukturwandel im Medienbereich abzufedern, sind Massnahmen dringend angezeigt – gerade auch angesichts der Corona-Pandemie, die die Situation der Medien weiter verschärft hat. Es ist mehr denn je wettbewerbsverzerrend und entspricht nicht mehr der Realität, wenn noch nach Medienerscheinungsform unterschieden wird.
Die KVF hatte das Massnahmenpaket zugunsten der Medien bereits Ende August aufgeteilt und die Online-Förderung so verzögert. Das Plenum des Nationalrats schickte die Vorlage im September jedoch wieder an die Kommission zurück mit dem Auftrag, das Paket insgesamt zu beraten. Dies auch vor dem Hintergrund der Appelle verschiedener Medienverbände und Verleger*innen, die auf die Dringlichkeit der Vorlage hingewiesen hatten.
Die Verwaltung hat der Kommission in den letzten Monaten bereits umfangreiche Dokumentationen zur Verfügung gestellt. Der VMZ hat sich an den entsprechenden Umfragen beteiligt und kennt daher die angefragten Sachverhalte, die alle wesentlichen Fragestellungen beinhalten. Vor diesem Hintergrund können die diversen neuerlichen Prüfaufträge nur als weitere Verzögerungstaktik interpretiert werden.
Für den VMZ ist eine Online-Förderung, die nur die IT-Infrastruktur fördert, nicht zweckgemäss und bei weitem nicht ausreichend. Diese Kosten sind sehr unterschiedlich bezüglich Zeitpunkt und Unternehmensgrösse. Bei kleineren Medienbetrieben z.B. erreichen die Serverkosten keine fünfstellige Zahl. Eine Analogie zur Höhe der Posttaxenverbilligung besteht hier also nicht.
Ebenso ist wenig sinnvoll, die Förderung nur über Steuererleichterungen durchzuführen. Der VMZ ist auch gegen ein Gegeneinanderausspielen von Print und Online, sondern hat sich immer dafür eingesetzt, dass Medien unabhängig von ihrer Produktions- und Erscheinungsform gefördert werden. Nur das ist zukunftsgerecht.
Der Verband Medien mit Zukunft appelliert an die KVF-N, die Beratungen zum Medienförderungs-Paket unverzüglich fortzusetzen. Wenn die Beratungen von National- und Ständerat nicht in der Frühlingssession abgeschlossen werden, kann nicht einmal gewährleistet werden, dass das Gesetz per Anfang 2022 in Kraft tritt. Das könnte für einige Medienbetriebe bereits zu spät sein.